LUKS: Kommunale Politik für gerechte Chancen in den Sozialräumen!
LUKS: Kommunale Politik für gerechte Chancen in den Sozialräumen!
Die Lebenswirklichkeit der Menschen zeigt sich konkret in ihrem direkten Wohnumfeld. Ob es in einer Stadt gerecht zugeht, das ist vor Ort am besten zu erkennen. Hier zeigt sich, wo kommunale Politik ansetzen muss.
Hauptergebnisse:
- Im Zentrum steht für uns die Jugend. Wenn Sozialräume ein hohes Defizit an gerechten Lebenschancen aufweisen, dann sind es auch Bezirke mit einem hohen Anteil an Jugendlichen. Umweltbelastungen, fehlende Erziehungs- und Bildungseinrichtungen gehen einher mit einem sozialen Umfeld, das es schwierig macht, Chancen zu ergreifen. Das bedeutet für uns: Jugendpolitik ist Sozialpolitik ist Klimapolitik.
- Das hervorstechendste Merkmal ist das Ausmaß der Ungleichheit, welche zwischen den Bezirken herrscht. Dass es Unterschiede gibt, steht außer Zweifel, aber die schockierende Höhe überrascht, zumal wenn man bedenkt, daß in der ersten Gruppe ein Viertel der Einwohner erfasst ist. In der ersten Gruppe stehen die Chancen um ein Fünffaches schlechter als in der sechsten Gruppe!
- Die Belastung durch Umwelteinflüsse hängt sehr eng mit der Bevölkerungsdichte zusammen. Diese wiederum ist stark sozial beeinflusst. Arm wohnt dicht. Armut ist ein krasses ökologisches Risiko.
- Bildungsferne hat eine konkrete räumliche Dimension. Kindertagesstätten und Grundschulen liegen oftmals nicht unmittelbar wohnungsnah. Es müssen erst einmal Wege zurückgelegt werden. Die ersten Hürden sind die höchsten. Dies hat schwerwiegende Folgen für die Entwicklung kindlicher Fähigkeiten.
- Arm wohnt eng. Sowohl die Wohnqualität in bezug auf die Fläche der einzelnen Wohnung als auch in bezug auf die Ballung der Wohnungen ist ein deutliches Zeichen der Benachteiligung.
- Der Faktor Migration ist ein Verstärker. Menschen mit Migrationshintergrund haben es schwerer, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und zu betätigen. Sie müssen zudem erst mannigfache Beeinträchtigungen überwinden, um sich zu entfalten. Sie können der Gesellschaft nur wenig zurückgeben, weil sie nur wenig empfangen haben.
- Arbeitslose, Menschen mit beeinträchtigter Erwerbsfähigkeit und alte Menschen mit zu niedrigen Renten beziehen SGB-Leistungen. Im Durchschnitt ist ein Fünftel der gesamten Bevölkerung Leistungsbezieher. Aber: Es gibt Bezirke, in denen dies für zwei Fünftel der Bevölkerung zutrifft. Menschen mit zu wenig Entfaltungschancen wohnen und leben häufig beieinander. Das verlängert und vermindert den Ausschluss von Möglichkeiten sich zu entwickeln.
Wie sind wir zu unseren Ergebnissen gekommen?
Wir haben in der amtlichen Statistik Messgrößen für bestimmte Themen gesucht. Für die Umweltqualität konnten wir uns z.B. ansehen, wie viele Menschen auf einem Quadratkilometer zusammenleben (Bevölkerungsdichte). Eine sehr hohe Bevölkerungsdichte führt zu einem sehr niedrigen Wert – und umgekehrt. Weiter haben wir uns für die Umweltqualität daran orientiert, wie viele Häuser mit mehr als sieben Wohnungen es in einem Bezirk gibt. Je mehr Häuser mit vielen Wohnungen, desto niedriger der Wert – und umgekehrt.
Insgesamt haben wir zwölf solcher Messgrößen verwendet. Uns ging es neben dem Wohnen um die Plätze in Kindertagesstätten und Grundschulen, um den Anteil der Frauen, die mehr als nur geringfügig beschäftigt sind, um den Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund und um die Bezieher*innen von SGB-Leistungen. Wenn ein Bezirk es bei vielen Messgrößen jeweils nur zu einem niedrigen Wert geschafft hat, dann hat er insgesamt nur wenige Punkte.
Die Ergebnisse schwanken von 25 Punkten für den Bezirk Schinkenplatz und 215 Punkten für den Bezirk Traar-West. Das ist eine extrem hohe Spannweite. Wir haben sie durch die Bildung von Gruppen und Durchschnitten gemildert. Gleichwohl ist das, was als Segregation bezeichnet wird, in Krefeld sehr stark ausgeprägt.
Nun stellen wir die Messgrößen ein wenig genauer vor:
Die Ergebnisse im Detail: Welche Messgrößen wir benutzen:
-
Bevölkerungsdichte und ökologische Lebensqualität:Viele Menschen müssen sehr dicht aufeinander leben. Die ersten Wahrnehmungen der Umwelt sind Lärm, Gestank, Beton und Asphalt. Grün, Stille, Weiträumigkeit – was uns Ruhe und Ausgleich verschafft, das fehlt.
-
Bildung:Wer am leichtesten Entfernungen überbrücken kann, für den liegen Kindertagesstätten und Grundschulen meist in der Nähe. Wer sich schwertut, sein Kind betreuen zu lassen, weil er kein Auto hat oder zu wenig Geld, der hat noch dazu größere Entfernungen zurückzulegen. Besser eine Betreuung in einem ehemaligen Ladenlokal als hoch getunte Kinderzentren.
-
Erwerbstätigkeit:Am Erwerbsleben teilzunehmen, sollte heißen: seine Fähigkeiten unter Beweis stellen zu können, mit Menschen zusammen etwas zu leisten, nicht nur sinnlose Tätigkeiten, Stress, Konkurrenz, Hierarchien und Meetings. Weibliche Erwerbstätigkeit, sofern sie nicht ohnehin nicht nur nötig, sondern auch gewünscht ist, enthält einen Akzent der Qualifikation und der Motivation gegenüber der Erwerbsbeschäftigung insgesamt. Hier führt uns ein Umweg zum Ziel, aber dafür ist er sehr aussagekräftig.
-
Wohnen:Viele Menschen können sich ein Zuhause, das ihnen Ruhe und Platz zur Entfaltung bietet, schlichtweg nicht leisten. Sie müssen mit lauten, engen und teuren Buden vorliebnehmen.
-
Migration:In vielen Stadtteilen haben mehr als die Hälfte oder sogar zwei Drittel der Bevölkerung einen Migrationshintergrund. Das ist also eher ein selbstverständlicher Teil des Lebens. Die Kulturen kommen in Berührung. Erfahrungen werden ausgetauscht. Horizonte öffnen sich. Vielfalt ist Reichtum.
-
SGB-Leistungsbezieher*innen:Vielen Menschen fehlt es an Mitteln, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Daher bedürfen sie der Unterstützung. Der Missbrauch von Leistungen ist dabei recht selten. Viel häufiger wird aber mit Armut und Wohnungsnot noch richtig Geld verdient.
Zusatz: Angaben zu gesundheitlichen Verhältnissen fehlen auf kleinräumlicher Ebene leider vollständig. Sie müssten aus anderen Quellen rückerschlossen werden.
Die Ergebnisse im Detail: Was sagt das für die Sozialräume aus?
Wir haben sechs Gruppen mit jeweils sieben Sozialräumen gebildet. Die Gruppe mit den deutlichsten Bevorzugungen hat ein Fünffaches mehr an Lebensgunst aufzuweisen als die Gruppe, welche das Schlusslicht bildet! Was als Fachausdruck Segregation heißt, das ist in der Stadt Krefeld so deutlich ausgeprägt wie sonst nur im Ruhrgebiet oder in Regionen Ostdeutschlands.
Um zu verhindern, dass sich die Ungleichheit noch weiter verfestigt, sind zahlreiche und teils kleinteilige Maßnahmen erforderlich. Ein Beispiel: Bestens ausgestattete Kinderbetreuungseinrichtungen helfen wenig, wenn sie für viele nur schwer zu erreichen sind.
- In der ersten Gruppe leben mit fast 60.000 Menschen ein Viertel der Bevölkerung. Es sind die Innenstadtbezirke Schinkenplatz, Stephanplatz, Vier Wälle, Südring und Stadtgarten sowie die Bezirke Bleichpfad und Lehmheide. Hier ist eine krasse Benachteiligung zu verzeichnen.
- Die zweite Gruppe umfasst die Bezirke Hammerschmidtplatz, Dießem, Benrad-Nord, Stahldorf, Inrath, Oppum und Baackeshof. Hier leben über 40.000 Menschen, die von deutlichen Benachteiligungen betroffen sind.
- Die dritte Gruppe umfasst Uerdingen-Markt, Elfrath, Gartenstadt, Linn, Cracau, Uerdingen-Stadtpark und Gatherhof mit fast 40.000 Menschen. Hier sind die Lebensverhältnisse schon leicht überdurchschnittlich.
- In der vierten Gruppe leben fast 30.000 Menschen. Hier sind die Bezirke Kempener Feld, Tierpark, Königshof-West, der Ortskern Hüls, Lindental/Tackheide, Hohenbudberg und Königshof. Hier können die Lebensverhältnisse als recht auskömmlich angesehen werden.
- Die fünfte Gruppe mit fast 40.000 Menschen umfasst Niederbruch, Roßmühle/Steeg, Fischeln-West, Oppum-Süd, Fischeln-Ost, Sollbrüggen und Kliedbruch. Hier wird schon grün und recht angenehm gelebt.
- In der sechsten Gruppe mit fast 30.000 Menschen sind die wohlständigen und teils ländlichen Bezirke Stadtwald, Gellep-Stratum, Forstwald, Traar-Ost, Flöthbach/Plankerdyk, Verberg und Traar-West versammelt.
Wer möchte sich gern näher informieren?
Wer sich für diese Arbeit näher interessiert, kann uns gerne eine Mail schreiben. Wir schicken ihm dann eine excel-Datei mit unserer Auswertung.

Kontakt
Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Wir sind für jeden Input dankbar und beantworten gerne Fragen zu unseren Zielen, unserem Programm, oder dem Thema, das dir am Herzen liegt.
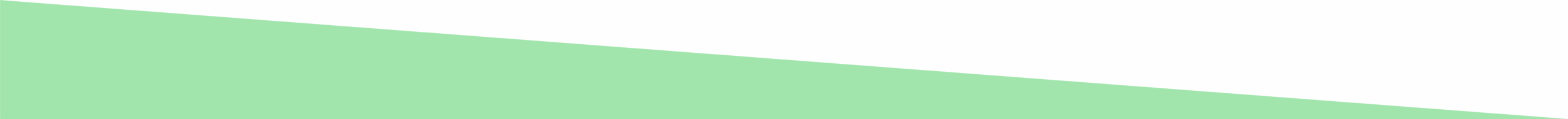

Spendenkonto: IBAN DE28 4306 0967 1358 1107 00